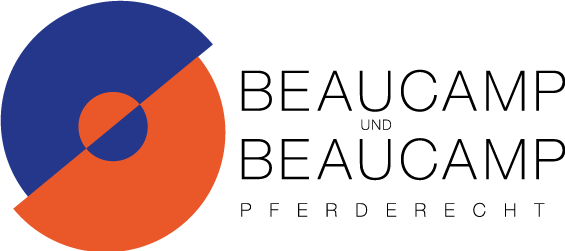Landgericht Nürnberg-Fürth, Hinweisbeschluss vom 16.10.2017, Az. 16 S 5049/17
Vorinstanz: Amtsgericht Nürnberg, Urteil vom 13.07.2017, Az. 239 C 1390/17
Der Sachverhalt
Die Beklagte besuchte mit ihren drei und fünf Jahre alten Enkelkindern die Reithalle einer nahe gelegenen Reitanlage. Damit ihr dreijähriges Enkelkind die Reiter mit ihren Pferden besser sehen konnte, setzte die Beklagte es auf die Holzbande. Dort baumelten die Beine des Kindes, sodass seine Turnschuhe gegen die Holzwand stießen.
Zu diesem Zeitpunkt führte die Klägerin ihr Pferd am langen Zügel durch die Reithalle. Das Pferd der Klägerin erschrak durch das von dem Enkel der Beklagten verursachte Geräusch und ging rückwärts. Durch die plötzliche Rückwärtsbewegung des Pferdes rutschte die Hand der Klägerin in den Zügel und wurde nach hinten gerissen. Die Klägerin erlitt eine Schulterverletzung. Neben einem Schmerzensgeld von 3.000 Euro verlangte sie von der Beklagten auch den Ersatz des Haushaltsführungsschadens in Höhe von fast 2.000 Euro.
Die Entscheidungen
Das Amtsgericht wies die Klage ab. Der Beklagten sei der Schaden nicht zurechenbar. Sie habe sich sozialadäquat verhalten. Es sei nachvollziehbar, ihr Enkelkind auf den Rand der Bande zu setzen, um den Pferden und Reitern zusehen zu können. Ihr sei höchstens geringfügig vorzuwerfen, dass die Füße des Kindes in den Reitbereich hineinragten.
Im Übrigen sei allein das Verhalten des Pferdes, welches in den Zurechnungsbereich der Klägerin fällt, für die Verletzung der Klägerin ausschlaggebend. Für die Beklagte sei es weder vorhersehbar noch vermeidbar gewesen, dass das Pferd auf Poltergeräusche so schreckhaft reagieren werde.
Gegen dieses Urteil legte die Klägerin Berufung beim Landgericht Nürnberg-Fürth ein, nahm diese aber nach dem Hinweisbeschluss des Landgerichts zurück. Das Landgericht bestätigte nicht nur die Ansicht des Amtsgerichts, es ging sogar darüber hinaus.
An der Reithalle befand sich weder ein Hinweisschild, noch würden die Besucher anders vor dem Betreten der Reithalle darauf hingewiesen werden, dass man sich möglichst leise verhalten müsse. Vor allem hinsichtlich Alltagsgeräuschen – wie dem Poltern der Bande – hätte es eines ausdrücklichen Hinweises bedurft.
Copyright
Rechtsanwältin Susan Beaucamp
Foto: Fotalia