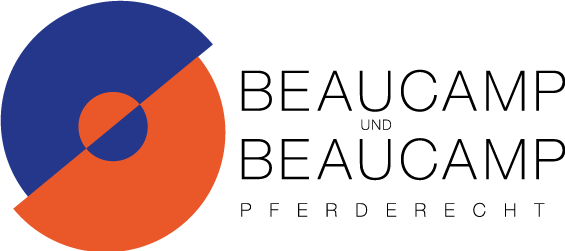Pferderecht Pferdekauf – Sachmangel – Rückabwicklung Pferdekauf wegen „Rittigkeitsproblemen“(Widersetzlichkeiten“, „Kissing Spines“)
Im Mai 2020 hatte der BGH sich erneut mit dem Thema „Sachmangel beim „Tierkauf“ zu befassen. (vgl. vom 27. Mai 2020 – VIII ZR 315/18). Der BGH hat im Wesentlichen seine bisherige Rechtsprechung bestätigt und ergänzt.
Folgender Sachverhalt lag der Entscheidung des BGH zugrunde:
Es ging um die Frage, ob die fehlende Rittigkeit eines Pferdes ein Mangel ist. Die Klägerin erwarb in einer Auktion ein Pferd als Sportpferd. Als nach einiger Zeit Rittigkeitsprobleme mit dem Pferd auftraten, focht die Klägerin den Kaufvertrag wegen arglistiger Täuschung an. Die Rittigkeitsprobleme würden auf Mängel im Skelett, entstehende Dornenfortsätze der Wirbelsäule (sog. „Kissing Spines“), beruhen und sie verlangte vom Verkäufer Zug um Zug Rückzahlung des Kaufpreises gegen Rückgabe des Pferdes.
In der Revision führte der BGH aus, dass zwischen den Parteien eine Beschaffenheitsvereinbarung in dem geschlossenen Kaufvertrag. zur gesundheitlichen Verfassung oder Rittigkeit, nicht getroffen worden war. Demnach kommt es auf die Möglichkeit der vertraglich vorausgesetzten Verwendung des Pferdes als Reitpferd an. Die Anforderungen, die bei Fehlen einer Beschaffenheitsvereinbarung an die gesundheitliche Verfassung eines Reitpferds zu stellen sind, sind herabzusetzen, denn es handele sich um ein Lebewesen.
Der Verkäufer eines Tiers hat, sofern eine anderslautende Beschaffenheitsvereinbarung nicht getroffen wird, (lediglich) dafür einzustehen, dass es bei Gefahrübergang nicht krank ist und sich auch nicht in einem (ebenfalls vertragswidrigen) Zustand befindet, aufgrund dessen bereits die Sicherheit oder zumindest die hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass es alsbald erkranken wird (Senatsurteile vom 29. März 2006 – VIII ZR 173/05, BGHZ 167, 40 Rn. 37; vom 18. Oktober 2017 – VIII ZR 32/16, NJW 2018, 150 Rn. 26; vom 30. Oktober 2019 – VIII ZR 69/18, aaO Rn. 25) und infolgedessen für die vertraglich vorausgesetzte (oder die gewöhnliche) Verwendung nicht mehr einsetzbar wäre.
Vor diesem Hintergrund hat der Senat bereits mehrfach ausgesprochen, dass die Eignung eines klinisch unauffälligen Pferds für die vertraglich vorausgesetzte oder die gewöhnliche Verwendung als Reitpferd nicht schon dadurch beeinträchtigt wird, dass aufgrund von Abweichungen von der „physiologischen Norm“ eine (lediglich) geringe Wahrscheinlichkeit dafür besteht, dass das Tier zukünftig klinische Symptome entwickeln wird, die seiner Verwendung als Reitpferd entgegenstehen (Senatsurteile vom 7. Februar 2007 – VIII ZR 266/06, NJW 2007, 1351 Rn. 14; vom 18. Oktober 2017 – VIII ZR 32/16, aaO Rn. 24; vom 30. Oktober 2019 – VIII ZR 69/18, aaO Rn. 26). Ebenso wenig gehört es zur üblichen Beschaffenheit eines Tiers, dass es in jeder Hinsicht einer biologischen oder physiologischen „Idealnorm“ entspricht (Senatsurteile vom 7. Februar 2007 – VIII ZR 266/06, aaO Rn. 19; vom 18. Oktober 2017 – VIII ZR 32/16, aaO; vom 30. Oktober 2019 – VIII ZR 69/18, aaO).
Der Verkäufer haftet daher nur für den Gesundheitszustand bei Gefahrübergang, und nicht für die Entwicklung. Dies gilt auch für Rittigkeitsprobleme, die als Risiko bei Lebewesen keinen Mangel nach § 434 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 oder 2 BGB darstellen. Auch ist ein „Kissing Spines-Befund“ nicht vom Grundsatz her vertragswidrig, sofern nicht bereits klar, oder sehr wahrscheinlich ist, dass das Pferd deswegen erkranken wird und somit für die vertraglich vorausgesetzte oder die gewöhnliche Verwendung nicht mehr einsetzbar ist.
Den Feststellungen des Berufungsgerichts war nicht zu entnehmen, dass das Pferd krank überhaupt krank war. Ein Kissing Spines-Befund, wie er hier gegeben ist, ist – wie oben ausgeführt – kein krankhafter Zustand. „Rittigkeitsprobleme“ ändern daran nichts. Eine veterinärmedizinische Definition des Begriffs der „Rittigkeitsprobleme“ existiert nicht (vgl. Senatsurteil vom heutigen Tag – VIII ZR 315/18, unter II 1 b bb (2) (b), zur Veröffentlichung in BGHZ bestimmt); etwas anderes hat auch das Berufungsgericht nicht festgestellt. Zwar hat es vereinzelt den Begriff der „Erkrankung“ genutzt. Dies beruhte jedoch darauf, dass es Widersetzlichkeiten als „klinische“ Erscheinungen angesehen hat und deshalb von einem Kissing Spines-Syndrom“ ausgegangen ist. Diese Annahme war laut BGH allerdings falsch
Das Berufungsgericht hatte fehlerhaft angenommen, das Pferd habe „klinische“ Erscheinungen beziehungsweise „klinische“ Symptome gezeigt, hier in Gestalt von Buckeln und Durchgehen. Klinische Erscheinungen eines Kissing Spines-Befunds können etwa Lahmheit, krankhafte Störungen des Bewegungsapparats oder offensichtliche Schmerzen sein. Zwar können „Rittigkeitsdefizite“ eines Pferds unter Umständen – mittelbar – auf einem Engstand der Dornfortsätze beruhen, weil Veränderungen der Dornfortsätze – wie der Sachverständige ausgeführt hat – eine mögliche Ursache von Rückenschmerzen sein können. Ein Schmerzgeschehen war vorliegend jedoch nicht in Erscheinung getreten, denn eine krankhafte (Rücken-)Symptomatik, wie etwa (Druck-)Schmerzempfindlichkeit, hatte das Berufungsgericht gerade nicht festgestellt. Daher stehen im gegebenen Fall bloße Widersetzlichkeiten beim Reiten in Rede, bei denen es sich – wie ausgeführt – nicht um klinische Erscheinungen von „Kissing Spines“ handelt. Soweit einzelne Passagen in den
Bloße Widersetzlichkeiten („Rittigkeitsmängel“) stellen aber – ohne besondere Beschaffenheitsvereinbarung oder besondere Vertragszwecke, wie etwa ein Verkauf als „Anfängerpferd“ – regelmäßig keine gewährleistungspflichtige Abweichung von der Sollbeschaffenheit eines Reitpferds dar. Gelegentliches unkontrollierbares Durchgehen eines Pferds ist zwar reiterlich unerwünscht und für Pferd und Reiter auch nicht ungefährlich, so dass es den Umgang mit dem Pferd und dessen Nutzung erschwert. Es ist jedoch für sich gesehen keine Verhaltensstörung, sondern gehört noch zum natürlichen Verhaltensmuster eines Pferds als Fluchttier (vgl. Zeitler-Feicht, Tierärztliche Praxis/Ausgabe G, 2005, 266; Voschepoth, § 476 BGB beim Pferdekauf, 2014, S. 268, 270).
Der Käufer eines lebenden Tiers kann nicht erwarten, dass er – auch ohne besondere (Beschaffenheits-)Vereinbarung – ein Tier mit „idealen“ Anlagen erhält, mit dem er gänzlich unproblematischen Umgang pflegen kann, zumal auch eine „Disharmonie“ beziehungsweise eine unzureichende Verständigung zwischen Pferd und Reiter selbst bei qualifizierten Reitern kein untypisches, sondern ein natürliches Risiko im Umgang mit dem Pferd ist (vgl. Senatsurteil vom heutigen Tag – VIII ZR 315/18, aaO unter II 1 b bb (3) (b)). Dies wird – aus tiermedizinischer Sicht – auch anhand des Röntgen-Leitfadens 2018 deutlich, in dem es unter anderem heißt: „Der Kauf des Lebewesens Pferd wird jedoch weiterhin […] ein nicht mit anderen ‚Handelsgütern‘ vergleichbares Risiko beinhalten […]“ (GPM-Fachinformation, aaO S. 14; siehe auch Stadler/Bemmann/Schüle, aaO S. 120).
Auch ist ein „Kissing Spines-Befund“ nicht vom Grundsatz her vertragswidrig, sofern nicht bereits klar, oder sehr wahrscheinlich ist, dass das Pferd deswegen erkranken wird und somit für die vertraglich vorausgesetzte oder die gewöhnliche Verwendung nicht mehr einsetzbar ist.
Für die Praxis bedeutet dies in Fortführung der Rechtsprechung des BGH, dass es darauf ankommt, ob die Sache für den beabsichtigten Zweck, den die Parteien dem Vertrag zugrunde gelegt haben, geeignet ist. Dabei sind der Vertragsinhalt und auch die Gesamtumstände des Vertrags zu berücksichtigen.
Nur wenn die Parteien eine bestimmte Beschaffenheit vertraglich vereinbaren, so übernimmt der Verkäufer die Gewähr für das Vorhandensein dieser Beschaffenheit. Wurde diese Beschaffenheit nicht vereinbart, so hat der Verkäufer nur dafür einzustehen, dass das Pferd bei Gefahrübergang nicht krank ist und sich auch nicht in einem Zustand befindet, bei dem mit baldiger Erkrankung zu rechnen ist und es folglich für die gewöhnliche oder die vertraglich vorausgesetzte Verwendung nicht mehr einsetzbar wäre.
Copyright
Rechtsanwältin Susan Beaucamp