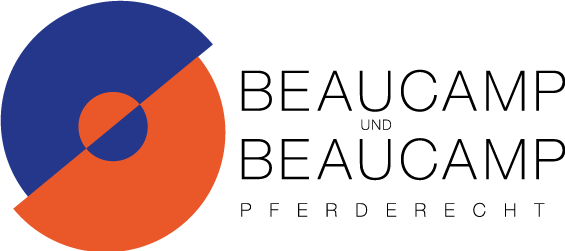KG Berlin, Beschl. v. 02.03.2017 – 11 U 5/16
Sachverhalt:
Der Kläger des vorliegenden Verfahrens buchte bei dem Beklagte eine Stunde Springtraining. Der Beklagte, der ein erfahrener Reitlehrer war, baute zu Beginn der Reitstunden einen In-Out-Sprung bestehende aus einem ca. 30 cm hohen Cavaletti und einem höheren Steilsprung auf. Der Abstand zwischen den beiden Sprüngen betrug ca. 2,40 m. Der Beklagte wies den Kläger an, das Hindernis zunächst im Trab anzureiten, wobei das Pferd des Klägers das Cavaletti zunächst umstieß. Anschließend sollte der Kläger das Hindernis im Galopp anreiten, was ihm auch zweimal hintereinander ohne weiteres gelang. Daher erhöhte der Beklagte den Steilsprung leicht auf ca. 80 cm. Bei dem darauffolgenden Versuch, das erhöhte Hindernis im Galopp zu überwinden, riss das Pferd des Klägers die obere Stange des Steilsprungs mit den Vorderbeineinen zu Boden und stürzte auf den Kläger. Der Kläger erlitt hierdurch erhebliche Verletzungen. Der Kläger verlangt von dem Beklagten Schadensersatz und Schmerzensgeld. Er behauptet, der Beklagte habe den Sturz dadurch verursacht, dass er die Abstände zwischen den Sprüngen falsch abgemessen habe.
Entscheidung:
Die Klage hatte weder in erster noch in zweiter Instanz Erfolg, da der Kläger dem Beklagten nicht die Verletzung einer für den Sturz ursächlichen Verkehrssicherungspflicht nachweisen konnte.
Da dem Springtraining zugrunde liegenden Vertragsverhältnis ist als Dienstvertrag gem. §§ 611 ff. BGB zu qualifizieren, da der Beklagte lediglich die Durchführung einer Unterrichtsstunde, nicht aber einen konkreten Ausbildungserfolg schuldete. Ein Schadensersatzanspruch aus dem Dienstvertrag kommt in Betracht, wenn dem Dienstleister die Verletzung einer Verkehrssicherungspflicht zur Last gelegt werden kann. Die Frage, wann bei einer Springstunde die Verletzung einer Verkehrssicherungspflicht angenommen werden kann, hängt vom jeweiligen Einzelfall ab. Ausschlaggebenden Faktoren sind dabei das Alter und der Ausbildungsstand von Pferd und Reiter, der Schwierigkeitsgrad der Übung und die Frage, ob das Hindernis ordnungsgemäß aufgebaut worden ist.
Da der Kläger des vorliegenden Verfahrens als durchaus erfahrenen Reiter mit seinem Pferd das Hindernis in der Reitstunden bereits zweimal problemlos überwunden hatte und das Pferd des Klägers in der Vergangenheit unstreitig bereits Sprünge bis zu einer Höhe von etwa 1,05 m erfolgreich gemeistert hatte, war nur noch fraglich, ob der Beklagte den Abstand zwischen dem Cavaletti und dem Steilsprung pflichtwidrig zu eng gewählt hatte. Denn die Richtlinien für Reiten und Fahren der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) sehen für ein In-Out „regelmäßig“ eine Distanz von 3 m oder mehr vor.
Nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme stand fest, dass dies vorliegend nicht der Fall war. Denn bei den Richtlinien der FN handelt es sich lediglich um Empfehlungen und nicht um verbindliche Richtlinien im juristischen Sinne. Der Trainer einer Springreitstunde kann daher individuell an Fähigkeiten und Merkmale von Pferd und Reiter angepasst die Abstände zwischen den Hindernissen wählen, d.h. also vergrößern als auch verkleinern. Einen „ordnungsgemäßen“ Abstand zwischen Cavaletti und dem nachfolgenden Hindernis existiert daher nicht.
Der Beklagte hätte den Kläger auch nicht darauf hinweisen müssen, dass er den Sprung erhöht hatte, denn die Erhöhung war so geringfügig, dass sie keinen Einfluss auf den Sprungablauf haben konnte.
Das im Rahmen der Springreitstunden aufgezeichnete Video ergab zudem, dass das Pferd nicht aufgrund des zu geringen Abstands gestürzt war, sondern weil sie unaufmerksam war. Eine Überforderung von Pferd und Reiter war zu keinem Zeitpunkt ersichtlich. Bei dem Sturz des Beklagten hatte sich vielmehr das dem Springreitsport naturgemäß innewohnende allgemeine Risiko verwirklicht. Eine Haftung des Beklagten schied daher aus.
Copyright
Rechtsanwältin Susan Beaucamp
Foto: Fotalia