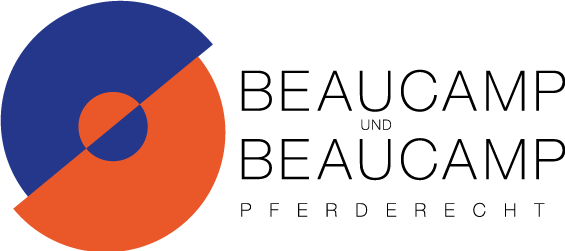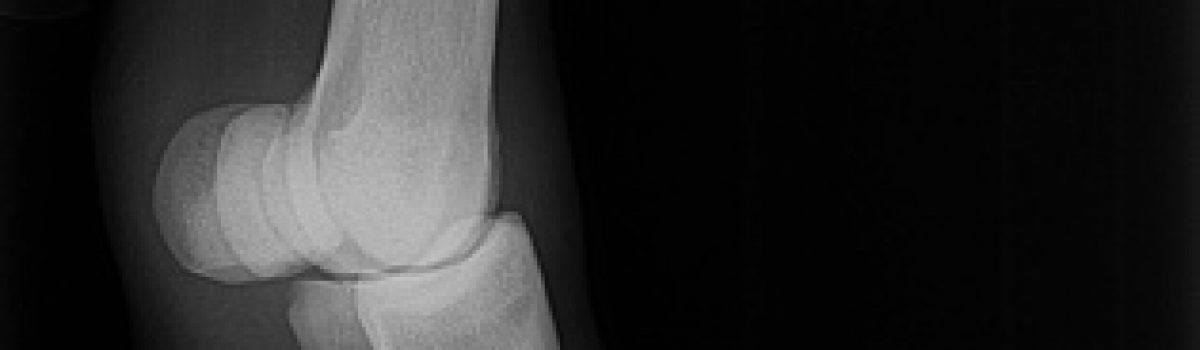Grober Behandlungsfehler – gilt Beweislastumkehr auch für Tierärzte?
BGH, Urteil vom 10.05.2016 – VI ZR 247/15
Sachverhalt:
Die Klägerin war am 08.07.2010 mit ihrem Pferd beim beklagten Tierarzt vorstellig, nachdem sie an der Innenseite des rechten hinteren Beins eine Wunde entdeckt hatte. Der Beklagte versorgte die Verletzung und gab die Anweisung, das Pferd müsse zwei Tage geschont werden, könne aber dann wieder geritten werden, soweit keine Schwellung im Wundbereich eintrete. Am 11.07.2010 wurde das Pferd dann geritten, wobei der Klägerin Taktunreinheiten im Bereich des verletzten Beines auffielen. Das Reiten wurde daraufhin eingestellt. Am 14.07.2010 brach das Pferd sich beim Aufstehen das Bein. Eine Operation gelang nicht und das Pferd musste eingeschläfert werden.
Die Klägerin hat beantragt, den Beklagten zu verurteilen, an sie 114.146,41 Euro Schadensersatz sowie außergerichtliche Rechtsanwaltskosten zu zahlen. Sie begründete ihre Klage damit, dass die am 08.07.2010 behandelte Verletzung durch den Schlag einer Stute verursacht worden sei und dieser zu einer Fissur des darunterliegenden Knochens geführt habe. Innerhalb der nächsten Tage habe sich die Fissur zu der am 14.07.2010 diagnostizierten Fraktur entwickelt. Der Beklagte habe behandlungsfehlerhaft auf eine Lahmheits- und Röntgenuntersuchung des Pferdes verzichtet. Dabei hätte die Fissur erkannt werden können.
Das LG Osnabrück und das OLG Oldenburg erklärten den auf Schadensersatz und darüber hinausgehende Rechtsanwaltskosten gerichteten Klageantrag für gerechtfertigt. Der Beklagte legte Revision ein.
Entscheidung:
Unterläuft einem Tierarzt a ein grober Behandlungsfehler, darf die Beweislastumkehr, die bereits auch in der Humanmedizin gilt zugunsten des geschädigten Tierhalters angewendet werden.
Das angefochtene Urteil hat im Ergebnis der revisionsrechtlichen Überprüfung standgehalten. Der Klägerin steht ein Anspruch auf Schadensersatz zu.
Da nicht geklärt werden konnte, ob es an dem Behandlungsfehler lag, dass sich das Pferd beim Aufstehen das Bein brach, war die zentrale Frage, wer den Beweis hinsichtlich der Kausalität erbringen muss. Normalerweise trägt die Klägerin die Beweislast. Folgte man vorliegend dieser Regel, hätte die Klägerin keinen Anspruch auf Schadensersatz, da der Kausalzusammenhang zwischen Behandlungsfehler und Fraktur nicht festgestellt werden konnte.
Die Vorinstanz habe jedoch zurecht eine Beweislastumkehr zu Gunsten der Klägerin wegen eines groben Verstoßes gegen die Pflichten aus dem tierärztlichen Behandlungsvertrag festgestellt. Der Grundsatz über die Beweislastumkehr aus der Humanmedizin findet entsprechende Anwendung.
Im humanmedizinischen Bereich führe ein grober Behandlungsfehler, der geeignet sei, einen Schaden der tatsächlich eingetretenen Art herbeizuführen, regelmäßig zur Umkehr der objektiven Beweislast. Dies ergebe sich daraus, dass die nachträgliche Aufklärbarkeit des tatsächlichen Geschehens wegen des besonderen Gewichts des Behandlungsfehlers und seiner Bedeutung für die Behandlung in einer Weise erschwert sei, dass es dem Patienten nicht zugemutet werden könne, den vollen Kausalitätsnachweis zu erbringen.
Die gleiche Problematik der Aufklärungserschwernisse finde sich auch bei grob fehlerhaften tiermedizinischen Behandlungen. Mithin sei die Anwendbarkeit der Beweislastumkehr unter diesem Gesichtspunkt zu bejahen. Ebenso sei die Tätigkeit eines Tierarztes mit der medizinischen Behandlung durch einen Humanmediziner vergleichbar, soweit es um die Heilung und Erhaltung eines lebenden Organismus gehe.
Über die tatsächliche Höhe des Schadensersatzanspruchs muss nun das Landgericht Osnabrück entscheiden.
Copyright
Rechtsanwältin Susan Beaucamp
Foto: Fotalia