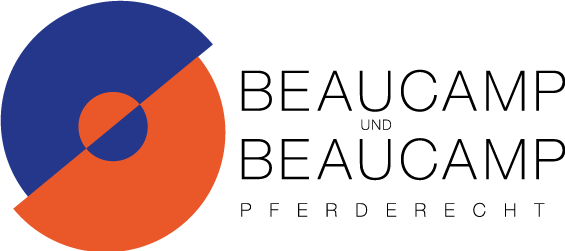Verschiedene Haftungstatbestände – ein Überblick für Pferdehalter
Umfassende Pferdehalterhaftung
Grundsätzlich können aus verschiedenen gesetzlichen Tatbeständen Haftungen für Pferdehalter hergeleitet werden aber Pferdehaltern auch Ansprüche im Zusammenhang mit ihrer Pferdehaltung gegenüber Dritten zustehen.
Unter Umständen kann ein Pferd ein „gefährliches Werkzeug“ im Sinne des § 224 I Nr. 2 Alt.2 StGB darstellen. § 224 StGB regelt die gefährliche Körperverletzung.
Ein gefährliches Werkzeug ist jeder Gegenstand, der nach seiner Beschaffenheit und der Art der Verwendung im konkreten Fall dazu geeignet ist, erhebliche Verletzungen hervorzurufen.
Aufgrund der Größe und des Gewichts des Pferdes, ist es prinzipiell geeignet, erhebliche Verletzungen herbeizuführen.
Beispielsweise kommt eine solche Haftung in Betracht, wenn eine Person mit dem Pferd auf eine andere losreitet, um sie zur Seite zu drängen und diese dabei verletzt wird.
Für die Haftung gem. § 224 I Nr. 2 Alt. 2 StGB ist aber Vorsatz zur Begehung der Tat erforderlich, das heißt, dass die reitende Person vorsätzlich die andere schädigen wollte.
Außerdem ist eine fahrlässige Körperverletzung gemäß § 229 StGB denkbar.
Der Halter eines Pferdes ist dazu verpflichtet, dieses zu überwachen und so abzusichern, dass Verletzungen und sonstige Schädigungen Dritter verhindert werden können. Es entsteht eine gesteigerte Sorgfaltspflicht. Unter Umständen kann es zu einer Haftung wegen fahrlässiger Körperverletzung kommen, wenn der Zaun der Weide nicht hoch genug ist, das Pferd mithin ausbrechen kann und anschließend einen Schaden an einem Menschen anrichtet.
Kommt der Mensch dadurch zu Tode, ist eine fahrlässige Tötung denkbar, § 222 StGB.
Des Weiteren kann an einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr, § 315 b StGB gedacht werden, wenn das Pferd bei seinem Ausbruch auf die Straße rennt.
Im Zuge der Haftung im Straßenverkehr muss auch darauf geachtet werden, dass wenn bei einem Überholungsmanöver eines Autofahrers das Pferd scheut und dadurch ein Schaden entsteht, ein Mitverschulden des Fahrers entstehen kann.
II. Zivilrechtliche Haftung
Es werden innerhalb der zivilrechtlichen Haftungen zwei grundlegend verschiedene Haftungsarten unterschieden. Zum Einen die vertragliche Haftung und zum Anderen die deliktische Haftung.
1. Vertragliche Haftung
Wie der Name bereits aussagt, ist hier Grundvoraussetzung für die Erfüllung des Tatbestandes, dass ein Vertrag vorliegt. Werden Pflichten aus diesem Vertrag verletzt, entsteht ein Schadensersatzanspruch.
Als gutes Beispiel ist der Einstellvertrag heranzuziehen.
Dabei geben Pferdehalter ihr Tier dem Einsteller zur Obhut, ein Einstellvertrag wird geschlossen. Während der Vertragslaufzeit ist das Tier im Obhutsbereich des Pensionsstallbetreibers.
Die Hauptleistungspflichten aus dem Vertrag sind die Verfügungstellung von Box und Weide, die Versorgung des Pferdes und die unbeschädigte Rückgabe des Pferdes nach Vertragslaufzeit.
Werden jene Pflichten verletzt, kann der Tierhalter Schadensersatz verlangen.
Außerdem können sogenannte Nebenpflichten aus dem Vertrag entstehen. Grundsätzlich verpflichtet jeder Vertrag nämlich den Vertragspartner zur Rücksicht auf die Rechte, Rechtsgüter und Interessen des anderen Vertragsteils. Vor allem sind dabei die sogenannten Aufklärungs- und Schutzpflichten von Bedeutung. An die Verletzung einer solchen Pflicht ist zu denken, wenn ein Tier mit einer ansteckenden Krankheit ebenfalls im Betrieb eingestellt wird. Der Tierhalter ist darüber zu informieren.
Ebenfalls wichtig sind die sogenannten Verkehrssicherungspflichten. Gegen solche wird verstoßen, wenn eine Gefahrenlage für Dritte geschaffen wird oder wenn die schon bestehende Gefahrenlage in seinem Verantwortungsbereich andauern lässt.
Der Einstellbetreiber haftet auch für ein schadenverursachendes Verhalten seiner Mitarbeiter, soweit es vorsätzlich oder fahrlässig herbeigeführt wurde. Zum Beispiel kann es passieren, dass ein Mitarbeiter ein Medikament für ein Tier falsch dosiert und dieses dann zu Schaden kommt.
Haftung vor Vertragsschluss:
Auch wenn bereits nur Vertragsverhandlungen geführt wurden, ist es möglich, dass eine Pflichtverletzung einen Schadensersatzanspruch begründet. Findet zum Beispiel eine Probereiten statt und ist der Boden nicht richtig gesäubert und die Person die reitet erleidet einen Schaden, so ist dies auch vom Einsteller zu verantworten.
Weitere Verträge:
Es gibt auch viele, viele andere Arten von Verträgen. Zum Beispiel ein Behandlungsvertrag mit dem Tierarzt, ein Kaufvertrag für ein Pferd, ein Pferdemietvertrag….
2. Deliktische Haftung
Innerhalb der deliktischen Haftung kann zwischen zwei verschiedenen Grundsätzen unterschieden werden. Es gibt den Fall der Verschuldenshaftung und den Fall der Gefährdungshaftung. Die deliktischen Haftungstatbestände sind in den §§ 823 – 853 BGB geregelt.
a) Verschuldenshaftung
Jede natürliche Person haftet für den von ihr hervorgerufenen Schaden, dessen Eintritt für sie vorhersehbar und vermeidbar war. Das „Verschulden“ dieser Haftung besteht darin, dass die Person die Ursache für den Eintritt des Schadens gesetzt hat oder nicht alles mögliche und zumutbare getan hat, um den Eintritt des Schadens zu verhindern, nachdem ein Geschehensablauf von ihr in Gang gesetzt wurde, der schlussendlich zum Schadenseintritt führte.
Als gutes Beispiel ist hier § 823 BGB heranzuziehen.
„(1) Wer vorsätzlich oder fahrlässig das Leben, den Körper, die Gesundheit, die Freiheit, das Eigentum oder ein sonstiges Recht eines anderen widerrechtlich verletzt, ist dem anderen zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet.
(2) Die gleiche Verpflichtung trifft denjenigen, welcher gegen ein den Schutz eines anderen bezweckendes Gesetz verstößt. Ist nach dem Inhalt des Gesetzes ein Verstoß gegen dieses auch ohne Verschulden möglich, so tritt die Ersatzpflicht nur im Falle des Verschuldens ein.“
Wichtig ist hierbei, dass IRGENDEINE Art von Verschulden vorliegen muss. Sei es, weil vorsätzlich ein Verhalten geplant war, oder fahrlässig die Weidetür offen stehen gelassen wurde, sodass das Pferd entfliehen konnte und auf der Flucht ein Auto geschädigt hat.
b) Gefährdungshaftung, § 833 S.1 BGB
Die Gefährdungshaftung ist wohl der wichtigste Haftungstatbestand für Tierhalter. Hier ist keine Art von Verschulden erforderlich. Dem Halter des Tieres kann keinerlei Fehlverhalten vorgeworfen werden. Tierhalter ist, wer an der Haltung ein eigenes Interesse, eine mittelbare oder unmittelbare und grundsätzlich nicht nur vorübergehende Besitzstellung und die Befugnis hat, über Betreuung und Existenz des Tieres zu entscheiden.
Grund für eine solche verschuldensunabhängige Haftung ist die besondere Gefährlichkeit, die von Tieren ausgeht. Denn Tiere haben ein unberechenbares und willkürliches Verhalten.
Zur Erfüllung dieses Tatbestandes ist die Verursachung des Schadens „durch ein Tier“ gefordert, das heißt, dass ein Zurechnungszusammenhang zwischen dem Schaden und dem Verhalten des Tieres vorhanden sein muss. Bei dieser Schädigungshandlung muss sich die „typische Tiergefahr“ realisiert haben. Dies meint, dass sich ein unberechenbares und selbstständiges Verhalten, welches der tierischen Natur entspricht, verwirklicht haben muss.
Jenes unberechenbare und selbstständige Verhalten kann ein Tierhalter nicht vollständig beherrschen, also eröffnet sich mit der Haltung des Tieres eine Gefahrenquelle. Diese Gefahrenquelle rechtfertigt eine strenge Haftung, auch für verschuldensunabhängiges Verhalten.
Beispiele sind das Scheuen eines Pferdes und ein anschließender Tritt oder dergleichen, wenn es sich erschreckt oder ein ungeahnter Deckakt auf der Weide.
Auch für Hundehalter ist dies wichtig. Wenn bei einem Spaziergang ein anderer Hund trotz Leine und anderer Maßnahmen sich mit einem anderen Hund zerbeißt.
Wichtig ist aber, dass keine typische Tiergefahr vorliegt, wenn das Tier aufgrund von menschlichen Weisungen handelt. Zum Beispiel wäre dies der Fall, wenn jemand seinen Hund auf eine andere Person hetzt.
§ 833 S. 1 BGB regelt die Haftung für sogenannte Luxustiere, darunter fallen im Normalfall Haustiere, die zu „Liebhaberzwecken“ gehalten werden. Oder aber Tiere, die nicht zu gewerblichen Zwecke genutzt werden.
Im Gegensatz zu § 833 S.1 BGB regelgt § 833 S. 2 BGB die Gefährdungshaftung für Nutztiere, dies können beispielsweise Zuchttiere sein, Vereinstiere oder Schlachttiere. Hierbei tritt eine Ersatzpflicht des Tierhalters nicht ein, wenn der dieser bei der Beaufsichtigung des Tieres die im Verkehr erforderliche Sorgfalt beobachtet oder der Schaden auch bei Anwendung dieser Sorgfalt eingetreten wäre.
III. Mitverschulden
Der Schadensersatzanspruch bei den Haftungstatbeständen kann verkürzt werden, sobald ein Mitverschulden der anderen Partei vorliegt, § 254 BGB.
Vor allem ist dies der Fall, wenn beispielsweise bei einem Überholmanöver eines Autofahrers an einem Pferd dasselbe scheut und das Auto beschädigt. Dabei wurde zwar die typische Tiergefahr realisiert, jedoch kann auf den Fahrer eine Verkürzung des Anspruchs drohen, weil er unter Umständen zu schnell gefahren ist oder nicht genügend Abstand gehalten hat. So kann es auch unter Umständen dazu kommen, dass der Fahrer die volle Verantwortung für seinen Schaden übernehmen muss.